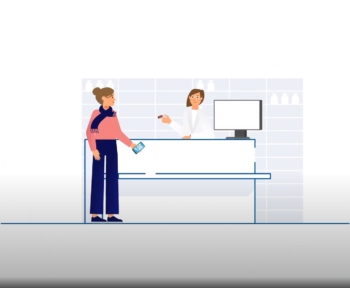Ein Interview über den Journalismus, den Job eines Journalisten und seine wichtigsten Aufgaben – Kai Biermann im Gespräch mit der Herderzeitung.
Ein Interview von Elisa Busch und Inken Hübner
Am 05. Mai 2021 besuchte der Journalist Kai Biermann im Rahmen des Tages der Pressefreiheit die Klasse 9es. Seit 1994 wird am 03. Mai an das Grundrecht der unabhängigen und freien Medien erinnert. Dieses Jahr stand der Tag unter dem Motto „Informationen als öffentliches Gut“. Zu Zeiten von Corona stehen die Medien unter großem Druck, Fake News von Fakten zu unterscheiden und die Bevölkerung aufzuklären.
Kai Biermann, als Investigativ- und Datenjournalist für ZEIT und ZEIT ONLINE tätig, beantwortete
Vor 24 Jahren begann Kai Biermann seine Arbeit als Journalist. Er betont besonders, dass es keine staatliche Ausbildung für diesen Beruf gibt. Es gibt zwei große, renommierte Journalistenschulen in Deutschland, eine in Hamburg und eine in München. Beide sind durch Zeitungsverlage organisiert, bieten aber im Jahr insgesamt nur wenige Plätze an. Um dort eine Ausbildung zu bekommen, muss man schon sehr viel können. Wenn man keine Ausbildung macht, lernt man den Beruf, indem man für zwei Jahre ein Volontariat bei einer Zeitschrift macht und alle Ressorts durchläuft. Er arbeitete bei verschiedenen Zeitungen und eine Zeit lang auch als freier Journalist.
Presse soll denen eine Stimme geben, die sonst keine haben.
Kai Biermann, deutscher Journalist und Autor
Wie sieht ein normaler Tag von Ihnen aus?
Ich versuche, viel raus zu kommen, weil es bei uns heißt, dass man am besten über etwas berichten kann, was man selber gesehen und erlebt hat. An einem normalen Tag komme ich so zwischen neun und halb neun in die Redaktion. Dann beginnt der Tag mit einer Konferenz, in welcher wir besprechen, was wir heute machen. Ich weiß meistens schon, woran ich arbeite, weil ich mich längerfristig mit Themen beschäftige. Ich mache mir immer einen Plan, was ich zu tun habe.
Mit Lesen und Kommunikation verbringe ich die meiste Zeit des Tages. Man kann mich irgendwie auf siebenunddreißig Wegen erreichen und ich verbringe wirklich viel Zeit damit, E‑Mails, Signal, WhatsApp, Briefe und so weiter zu lesen. Dann recherchiere ich natürlich auch noch und schließlich schreibe ich.
Journalismus ist ein sehr freier Beruf, was für mich ein sehr großes Glück ist. Ich kann den Beruf wirklich empfehlen. Nicht, wenn man reich werden will, aber wenn man Spaß haben will.
Wo arbeiten Sie? Im Büro mit anderen oder von zu Hause aus?
Wäre jetzt nicht Pandemie, dann würde ich in einem relativ großen Raum sitzen mit dreißig bis fünfzig anderen. Da hätte ich dann einen Schreibtisch in einer Ecke. Stellt euch das vor wie in einem langen Raum, so breit wie eure Schule und da sind dann überall Schreibtischinseln verteilt. Dann gibt es ein Zentrum, wir nennen das das Desk. Da sitzen die, die die Website steuern und das Tagesgeschehen planen und drumherum sitzen die ganzen Fachredaktionen.
Beim Journalismus geht es um Geschwindigkeit. Da gibt es wieder einen Kernsatz: „Sei der Erste, der es berichtet oder sei der Erste, der es richtig berichtet.“ Das heißt, bei aktuellen Entwicklungen stehst du unter großem Zeitdruck, wo ganz viel ganz schnell entschieden werden muss. Das geht leichter, wenn man unkompliziert miteinander reden kann und eben beieinandersitzt.
Beim Online-Journalismus brauchst du viele Teams. Ich arbeite seit vielen Jahren sehr oft mit Leuten zusammen, die was von Daten verstehen, die programmieren können und die das graphisch umsetzen können, damit am Ende nicht nur ein roher Text entsteht, sondern ein Gesamtbild mit Bildern und Videos.
Seit letztem Jahr sitze ich aber Zuhause und wir müssen alles über zum Beispiel Zoom oder Signal regeln. Das ist sehr viel mühsamer.
Was ist Ihrer Meinung nach guter Journalismus?
Journalismus soll dabei helfen, dem sogenannten informierten Bürger zu helfen. Jeder Bürger in einer Demokratie hat das Recht, sich informieren zu können. Frei, unbeeinflusst und umfassend. Guter Journalismus ist in meinen Augen, wenn es mir gelingt, Leute ehrlich, umfangreich und faktenvoll zu informieren. Jeder Fernsehbeitrag, jeder Text kämpft um Aufmerksamkeit. Natürlich ist ein Beitrag toll, wenn er wahnsinnig informativ ist. Wenn er dann aber geschrieben ist wie ein Wikipedia-Eintrag, muss man selbst entscheiden, ob man sich damit informieren möchte. Es muss also auch spannend geschrieben sein. Natürlich muss guter Journalismus auch sauber recherchiert sein. Man muss also die richtigen Fakten spannend rüberbringen.
Jeder Bürger in einer Demokratie hat das Recht, sich informieren zu können. Frei, unbeeinflusst und umfassend.
Kai Biermann arbeitete u.a. für ZEIT und ZEIT ONLINE
Es gibt auch schlechten Journalismus. Nämlich schlampig, unter Zeit- oder Gelddruck. Unter solchen Umständen hat man nicht die Zeit, die man zum Recherchieren braucht, sondern muss ständig und schnell liefern. Dann gibt es auch diese Medien, die bewusst manipulieren. Sie wollen nicht nur über Politik berichten, sondern Politik machen. Eine Meinung verstärken und hervorrufen. Das finde ich schwierig, aber auch das ist Teil
Wie viel verdient man als Journalist durchschnittlich im Monat?
Das hängt sehr davon ab, in welchem Bereich des Journalismus man arbeitet, für wen und ob man angestellt ist oder nicht. Freie Journalisten verdienen oft sehr schlecht, in seltenen Fällen auch sehr gut, aber sie verdienen in Deutschland zwischen 2500€ und 3500€ brutto im Monat. Allerdings müssen sie dann z.B. die Krankenversicherung selbst bezahlen. Freier Journalismus ist hart. Wenn man beim Fernsehen angestellt ist, kann man sehr viel Geld verdienen. Das sind aber wenige und seltene Jobs. Die klassischen Journalisten, die verdienen je nach Berufsalter zwischen 3500€ und 5500€ brutto. Aber es ist nichts, womit man reich wird.
Woher weiß man bei Recherchen, ob es eine richtige Information ist oder eine Falsche?
Das ist die sogenannte Quellenbewertung. Ist Wikipedia zum Beispiel eine saubere Quelle? Das Problem ist dort nicht, dass jeder reinschreiben kann, sondern, dass es erstmal da stehen bleibt. Es dauert eine ganze Weile, bis jemand drüber geschaut hat. Wikipedia ist aber besser geworden. Früher war es sehr viel schlimmer. Für mich ist Wikipedia durchaus eine Quelle, weil am Ende des Artikels andere Quellen verzeichnet sind. Ich gucke mir dort häufig Artikel an, lese den Text aus Interesse, aber vor allem die Quellen, die unten aufgeführt worden sind: Wo wird was aus dem Artikel gesagt? Und dann gehe ich zu der Originalquelle und schaue sie mir an. Das ist für mich wirklich ein Schatz. Außerdem finde ich auf Wikipedia auch Gegenbelege, das heißt ich finde nicht nur Quellen, die das bestätigen, was ich suche, sondern auch widerlegen.
Das ist schon ziemlich cool für meine Arbeit. Aber natürlich ist es ein grundlegender Aspekt meiner Arbeit, Quellen zu überprüfen. Ich habe gerade so einen Fall, da suchte ich jemanden, der mir über ein bestimmtes Feld etwas erzählen konnte und hatte jemanden gefunden. Ich habe den nicht direkt angefragt, sondern versucht Menschen zu finden, die ihn kannten und habe gefragt, ob er unabhängig ist. Erst, als jemand, den ich für vertrauenswürdig hielt, mir das bestätigen konnte, habe ich ihn angerufen. Ein großer Teil meiner Arbeit ist es, zu jemandem zu gehen, mir was erzählen zu lassen, das mitzuschreiben und dann hinterher zu überprüfen. Und sehr oft ist da Mist dabei. Eine der größten Gefahren in meinem Beruf ist es in meinen Augen, zu schnell Menschen und Quellen zu vertrauen. Besonders Kollegen zu vertrauen, weil man nie weiß, ob die alles überprüft haben.
Wie haben Sie den Journalismus für sich entdeckt?
Meine Eltern waren beide Journalisten. Meinen ersten journalistischen Text habe ich im Studium geschrieben. Ich habe aber schon zu DDR-Zeiten versucht, Journalist zu werden. Das ist mir aber nicht gelungen, weil ich ideologisch nicht gefestigt genug war.
In der DDR hatte Journalismus eine ganz andere Funktion. Da ging es nicht darum, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Im Gegenteil. Da ging es darum, das wiederzugeben, was die Regierung einem sagt, was man wiedergeben soll. Es gab keine Pressefreiheit. Und dumm wie ich war, wollte ich damals schon Journalist werden und zum Glück ist es mir nicht gelungen. Das hat auch viel mit meiner Mutter zu tun. Meine Mutter war Reporterin und hat mich als Kind manchmal auf Reportage-Reisen mitgenommen. Das hat mich schon geprägt. Aber die Entscheidung, Journalist zu werden, habe ich erst viel später getroffen. Da spielte eher eine Rolle, dass ich gerne ein Leben leben wollte, was mich nicht langweilt und das ich spannend finde. Ich konnte mir vorstellen, dass das mit Journalismus funktioniert. Ging mal besser und mal schlechter. Seit ein paar Jahren richtig gut.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten?
Ich langweile mich nicht. Meine Themen kann ich mir selbst aussuchen und die Zeit auch selbst einteilen. Das ist für mich ein wahnsinniges Glück, weil ich mich für viele Themen interessiere und das auch ausleben kann. Recherche ist für mich das Spannendste überhaupt.
Inwiefern beeinflusst Ihr Beruf Ihr Privatleben?
Eben durch meine professionelle Neugier, wodurch ich auch im privaten Bereich frage: „Was? Erzähl mal!“ Oder über mein professionelles Misstrauen gegenüber allen oder darüber, dass ich alle anquatsche. Jeder Beruf beeinflusst dich. Guckt euch eure Lehrer*innen an, die haben auch sehr typische Verhaltensmuster.
Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste am Schreiben, damit ein Thema spannend wird?
Die Lebenswirklichkeit der Menschen wiedergeben, die beschrieben werden und die Lebenswirklichkeit der Menschen erreichen, die es lesen werden. Wir versuchen immer, die Geschichten so zu erzählen, dass jeder, der es liest, das Gefühl hat, das Thema ist für ihn wichtig. Ich versuche, den Menschen immer zu erklären, was ein Thema für sie bedeutet. Meistens denke ich auch, dass es funktioniert.
Was mögen Sie gar nicht am Schreiben?
Das Schreiben selbst, das ist anstrengend. Gute Texte zu schreiben, ist echt harte Arbeit. Allerdings ist es ein fester Bestandteil der Arbeit. Auch Kritik der Kolleg*innen anzunehmen. Es ist wichtig, sich gegenseitig Feedback zu geben und besser zu werden.
Wenn Sie in einem Bericht lügen würden, gäbe es dann Konsequenzen?
Ich hoffe doch! Natürlich, und zwar in verschiedenster Weise. Zuallererst ist da das Strafrecht. Lügen ist verboten für Journalisten. Da gibt es Regeln für. Ich darf nicht irgendwas über irgendjemanden behaupten, was nicht stimmt. Zum Beispiel darf ich nicht sagen, Politiker A ist schwul, obwohl er es gar nicht ist. Wenn ich das trotzdem tue, dann darf er mich mit Fug und Recht verklagen und mich so richtig rund machen. Das ist die rechtliche Lage. Du darfst jeden Presseartikel, in dem du dich falsch dargestellt siehst, vor Gericht bringen und Schadensersatz fordern. Für mich, der das dann verzapft hat, hat das natürlich auch Konsequenzen, denn mein Arbeitgeber würde sagen, dass das so nicht geht und im schlimmsten Fall werde ich dann entlassen. Zurecht, wenn du mich fragst.
Es passiert natürlich auch, dass ich nicht lügen wollte, aber etwas falsch berichtet habe, weil ich es nicht besser wusste. Wenn dann jemand kommt, der es besser weiß, weil er Experte auf diesem Gebiet ist, dann wird das korrigiert. Ich finde, dass das eine große Hilfe ist, weil oft Menschen auf einem Gebiet wahnsinnig viel Ahnung haben und meine Arbeit dadurch besser wird. Das ist dann keine Lüge, sondern falsche Berichterstattung aus unterschiedlichen Gründen. Lüge ist ja bewusste falsche Berichterstattung. Das Problem ist, dass es sowas wirklich gibt: die gelbe Presse, beispielsweise in der sogenannten Yellow Press. Das sind diese bunten Zeitschriften, die am Kiosk liegen, wo dauernd ein Promipaar drauf ist. Kurzgesagt, die Klatschpresse. Und in diesen Zeitungen stehen leider sehr viele Lügen drin. Auch das ist Teil der deutschen Medienlandschaft und Pressefreiheit. Man darf schon ganz schön viel, aber es gibt Grenzen und die werden im Zweifel, wie in einem Rechtsstaat üblich, von Gerichten gezogen. Dazu gibt es aber auch ethische Grenzen. Die sind im sogenannten Pressekodex festgelegt. Ich empfinde ihn als bindend und ich finde, alle Journalisten sollten sich an ihn halten.
Wie viele Artikel haben Sie schon geschrieben?
Wenn ich schätzen sollte, dann um die drei- bis fünfttausend. Das ist wirklich eine grobe Schätzung. Ich weiß, dass ich bei der ZEIT und ZEIT ONLINE – da bin ich jetzt zwölf Jahre – um die anderthalbtausend Texte geschrieben habe. Nicht jeder hat davon jetzt Buchlänge, manchmal sind es auch nur vier Absätze. Es ist also sehr relativ.
Gab es Themen, zu denen Sie eine emotionale Bindung hatten und bei denen es Ihnen schwerfiel, sachlich zu bleiben?
Rechtsextremismus ist zum Beispiel so ein Thema. Ich finde es sehr wichtig, sachlich zu bleiben, denn Debatten kann man nur halbwegs sachlich führen. Natürlich habe ich zu diesem Thema eine emotionale Bindung, kann es aber natürlich nicht in meinen Texten einfach so rauslassen. Es geht nämlich darum, Fakten zu präsentieren. Allerdings kann ich Kommentare schreiben und das mache ich auch. Überwachung ist ebenfalls so ein Thema. Ich bin in der DDR aufgewachsen und mein Vater ist ein Stasiopfer – wurde also jahrelang überwacht. Das war ein ziemlicher Schock. Eine lange Zeit habe ich auch darüber geschrieben und auch sehr viele Kommentare verfasst.
Was war Ihr bisher spannendster Fall?
Vor einigen Jahren haben wir uns mit Geflüchteten auseinandergesetzt und versucht, Menschen aus damaligen Flüchtlingslagern zu finden und zu schauen, wie sie jetzt leben. Dabei trafen wir auf einen Mann, der über das Mittelmeer geflüchtet ist. Seitdem hat er wahnsinnige Angst vor Wasser, weil er dort Menschen hat sterben sehen. Er allerdings hat seine Angst überwunden und ist Rettungsschwimmer geworden. Durch den Verein hat er auch Freunde und Anschluss an die Gesellschaft gefunden. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Wurden Sie schon einmal aufgrund Ihrer journalistischen Tätigkeiten bedroht?
Ich habe lange Zeit auch über Rechtsextreme berichtet und das ist ein Feld, in dem man recht schnell Drohungen bekommt. Die Drohungen waren nicht nur Hasskommentare, sondern auch E‑Mails mit „wir finden Sie und bringen Ihre Familie um“. Die öffentlichen Debatten haben sich in meinen Augen in den letzten Jahren stark verändert. Wir haben viele Kollegen, die auch bedroht werden. Um ehrlich zu sein, ich bin ein weißer Mann. Bei mir passieren Drohungen relativ selten. Ich habe eine vietnamesische Kollegin, die könnte Stunden darüber reden.
Wenn Sie Interviews führen, lenken Sie die Fragen dann in die Richtung, in der Sie die Antwort haben wollen?
Dann wäre ich ein ziemlich schlechter Journalist. Ich möchte erfahren, was der Mensch, den ich interviewe, über das Thema, welches mich interessiert, denkt. Das heißt, ich stelle möglichst offene Fragen. Würde ich das Interview in dieser Art lenken, würde ich mir die Chance nehmen, Dinge zu erfahren, welche ich vielleicht vorher gar nicht wusste, die aber wahnsinnig wichtig fürs Thema sind. Echte Recherche ist wie polizeiliche Ermittlung immer sein sollte, dazu da, etwas zu verifizieren oder falsifizieren.
Wurden Sie schonmal gezwungen, etwas zu schreiben?
Nein, da würde ich auch sofort kündigen. Bei so einem Unternehmen würde ich erst einmal nicht anfangen und ich wäre lieber arbeitslos, als dass mich jemand zwingt, irgendwas zu schreiben.
Ist es Ihnen schonmal passiert, dass ihre Quelle lügt, sie darüber berichten und dann die Person Sie verklagt?
Mir ist etwas Schlimmeres passiert. Eine Frau hat meiner Kollegen und mir etwas erzählt. Allerdings konnten wir das nicht zu einhundert Prozent überprüfen, weshalb wir es ihr geglaubt haben, weil wir sie für glaubwürdig hielten. Als wir ihr gegenüber saßen, hatten wir das Gefühl, dass sie die Wahrheit sagt und haben davon berichtet. Es war falsch. Es war komplett falsch und ausgedacht. Das kam raus und dann haben wir das alles aufgearbeitet und nochmal recherchiert und versucht, diese Frau zu finden. Die hatte sich umgebracht. Das war ziemlich schrecklich. Der Fall war deshalb so schrecklich, weil diese Person wirklich geglaubt hat, was sie uns erzählt hat. Sie war davon überzeugt und es ist sehr schwer, einen Lügner zu erkennen, wenn der glaubt, was er sagt. Die Frau war psychisch krank und diese Lügen waren Teil ihrer Krankheit. Das haben wir nicht erkannt, obwohl wir es hätten erkennen müssen. Jedoch haben wir es erst im Rahmen einer zweiten Recherche erkannt. Das war durchaus ein Tiefpunkt in meiner journalistischen Karriere. Natürlich wurde ich auch schon verklagt. Das ist leider Teil des Journalismus.
Was halten Sie von Schüler*innenzeitungen?
Finde ich super. Aus verschiedenen Gründen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem es sowas nicht wirklich gab. Unabhängige Presse gab es zum Beispiel auch nicht. Schülerzeitungen wurden auch nicht gerne gesehen. Eine Schülerzeitung ist dann richtig gut, wenn sie hinterfragt, was an der Schule passiert. Dann sind da nämlich nicht nur lustige Lehrersprüche drin, sondern es wird zum Beispiel gefragt, wie es dem Hausmeister so geht oder es gibt einen kritischen Text über die letzte Anordnung der Direktorin. Ein Kernsatz des Journalismus ist, „den Mächtigen die Wahrheit sagen“, und in eurem Leben sind die Lehrer die Mächtigen. Mit denen zu debattieren, finde ich super. Eben nicht alles hinzunehmen, was hier passiert, sondern auch zu hinterfragen. Das ist auch ein super Weg, um zu üben. Viele meiner Kolleg*innen waren früher auch in der Schülerzeitung, als erste Berührung mit dem Journalismus. Ich weiß, dass das viel Arbeit ist, also Respekt an alle, die es tun.
Helfen Sie der Polizei mit Ihrer Arbeit?
Nein, nicht wissentlich und willentlich. Das geht so weit, dass wir sagen, dass wir keine Informationen an die Polizei geben. Hat auch einen Grund. Es ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben nicht die rechtlichen Befugnisse und nicht die Möglichkeiten, Täter zu ermitteln. Das kann und darf und soll nur die Polizei. Wir können Aufmerksamkeit für ein Thema erzeugen und wenn Polizeibehörden darin Straftaten sehen, dann können sie das ermitteln, aber unser Job ist das nicht.
Ein Beispiel: Ich habe mal eine Geschichte recherchiert, da ging es über eine Webseite, über die illegal Waffen in Deutschland verkauft wurden, mit ganz schlimmen diskriminierenden Sprüchen dazu. Wir hatten die Daten der Käufer durch jemanden, der sie uns geschenkt hat. Wir wussten, wer das Zeug kauft. Darüber haben wir berichtet. Auch mit einer Karte, die zeigt, wo Waffen gekauft wurden. Daraufhin kam die Polizei und hat gefragt, ob sie die Daten haben kann. Allerdings entschieden wir uns dagegen, da es der Job der Polizei ist, es selbst rauszufinden. Außerdem ist es wichtig für uns, unsere Quellen zu schützen. Es ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, dass Menschen uns Informationen anvertrauen. Wenn sie fürchten müssen, dass wir damit dann zur Polizei gehen und sie dadurch vielleicht Ärger bekommen, würden viele nicht mehr mit uns reden. Denn polizeiliche Ermittlungen sind offen und die Namen der Quellen werden spätestens im Prozess öffentlich. Medien dürfen ihre Quellen dagegen verschweigen und das ist auch wichtig für unsere Arbeit. Die Person, die uns die Daten geschenkt hat, meinte daraufhin, dass er bereit wäre, mit der Polizei zusammen zu arbeiten. Das ist dann aber sein Ding, denn wir haben uns bewusst dafür entschieden, es nicht zu tun.
Die Herderzeitung bedankt sich für das Interview und die gewonnenen Einblicke in den Alltag eines Journalisten.
In unserer 10. Ausgabe führten wir bereits ein Interview mit einem Polizisten und lernten ein weiteres Berufsfeld kennen.